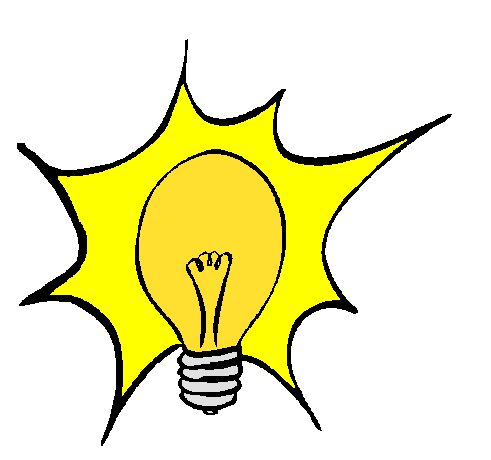
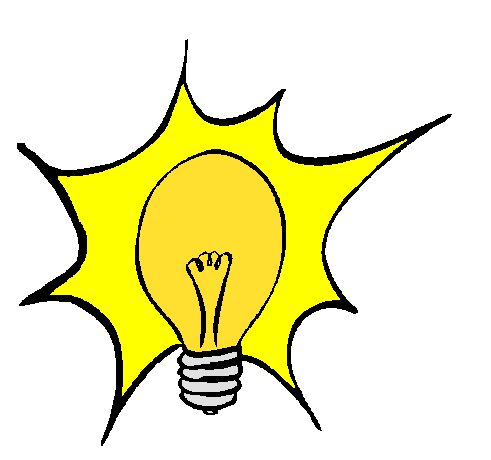
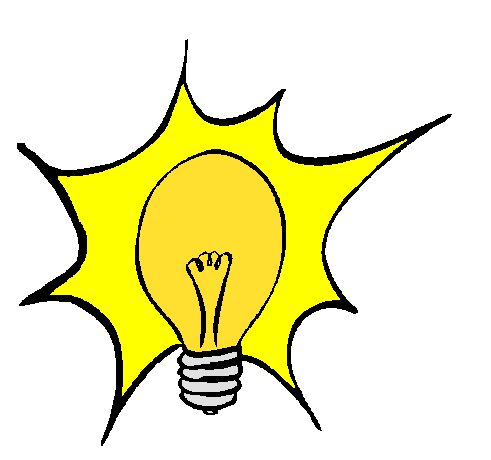 |
|
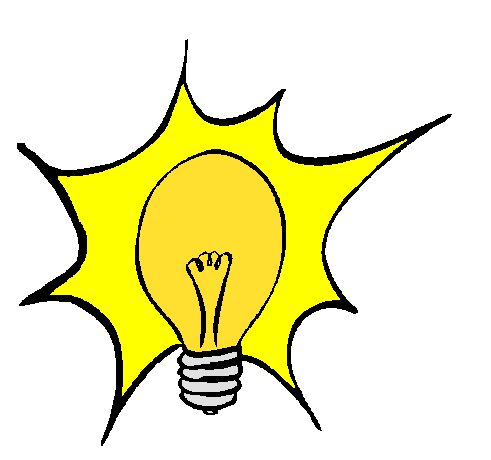 |
| Energiebewusst leben | Warmwasser |
| Worauf man beim Bau eines Hauses achten sollte | Literatur |
| Strom im Haushalt |
Energiebewusst leben
Die Energieverwendung im Haushalt verteilt sich wie
folgt:
|
Egger,C. (1998). Die Energieverwendung im Haushalt.. Energie Genie. Kap: Energiebew. leben.S.12 |
Die meiste Energie (56 Prozent) wird in einem Haushalt fürs Heizen benötigt. Nach dem Treibstoffbedarf für den PKW (31 Prozent) liegen Warmwasser und Haushaltsgeräte bei etwa 6 bis 7 Prozent des Energiebedarfs im Haushalt. Durch energiebewusstes Bauen können die Heizkosten stark gesenkt werden.
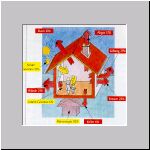 |
|
Egger, C. (1998). Energiegewinne und Verluste. Energie Genie. S21 |
Energiebewusstes Bauen beginnt
bereits bei der Planung. Damit diesbezüglich alle Aspekte und Zusammenhänge
berücksichtigt werden, sollte man schon im frühen Stadium das gesamten
Hauskonzepts mit einem Energieberater (Energieberater- Hotline 0800-205206) besprechen.
Der erste Schritt zu einem
Energiesparhaus beginnt mit der richtigen Wahl des Grundstücks.
In einer windgeschützten Südlage
wird man wesentlich weniger Heizenergie brauchen, als beispielsweise in
exponierter Lage auf dem Hügel.
Als Bauherr/frau mit Energiebewusstsein wird man natürlich "mit der Sonne
bauen" - in mehrfacher Hinsicht:
Man denkt bereits bei der Grundstückswahl
an eine mögliche spätere Nutzung von Sonnenenergie; Ausrichtung und Neigung
der Dachfläche sind also auf den Einbau von Sonnenkollektoren abgestimmt, das
heißt: Südausrichtung, eine Dachneigung von 30-60° für die
Warmwasserbereitung und 60-90° für Heizungszwecke.
Sie überprüfen, ob nicht Bäume, Sträucher oder Hügel ihr Haus ungünstig
beschatten.
Große Fenster werden südseitig liegen, die kleineren an der Ost- und
Westseite, Nordfenster werden am Besten klein gehalten oder ganz vermieden.
Berücksichtigen
sollte man auch im Zuge der Planung die Lage innerhalb des Verkehrsnetzes, die
Wege zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen usw., die täglich oder zumindest
häufig zu bewältigen sind sollten nicht weit entfernt sein.
Der Heizenergiebedarf für ein freistehendes Einfamilienhaus ist um bis zu 60%
höher, als der für eine vergleichbare Wohnung im verdichteten Flachbau
(Reihenhaus).
Ebenso einsichtig ist der Einfluss der Gebäudehöhe auf den Energiebedarf. Man
sollte daher nur so groß als nötig bauen.
Im Sinne möglichst niedriger Energiekosten ist es günstig, sich einen
Überblick über die möglichen Energiegewinne und -verluste eines Hauses zu
verschaffen:
Je stärker die Gebäudeoberfläche durch Erker etc. Gebäudeoberfläche durch Erker etc., gegliedert ist, desto höhere Energieverluste muss man in Kauf nehmen. Will man diesen Nachteil vermeiden, wird man bei der Grundrissplanung eine möglichst kompakte Bauform anstreben.
Bei Wärmedämmung und guter Wärmeschutzverglasung sollte man nicht sparen. Eine zusätzliche Investition macht sich in Form von niedrigen Heizkosten bezahlt.
Energiebewusst bauen bedeutet aber auch, sich Gedanken über die richtige Wahl der Baustoffe zu machen. Energieintensive Materialien, also Baustoffe, deren Herstellung mit hohem Energieaufwand verbunden ist, sollten möglichst sparsam eingesetzt oder überhaupt vermieden werden.
Wie
energiesparend ein Energiesparhaus wirklich ist, hängt zu guter Letzt vor allem
von den Bewohnern ab. Wer energiebewusst lebt, muss deswegen nicht auf Komfort
verzichten- er setzt Energie im Alltag nur richtig ein. Energiebewusst bauen und
leben bedeutet also vielmehr, bei niedrigem Energieeinsatz gleiche Behaglichkeit
zu erzielen.
Worauf man beim Bau eines Hauses achten sollte
| Undichte Fugen | Dachkonstruktion |
| Fenster | Sonnenschutz |
| Türen | Der Wintergarten |
Undichte Fugen
führen bei Gebäuden zu erhöhten Wärmeverlusten. Ähnlich
wie in die dickste Jacke bei starkem Wind dennoch Kälte eindringt, während
eine Windjacke vor Abkühlung schützt, ist bei Gebäuden neben einer guten Wärmedämmung
eine optimale Winddichtheit erforderlich, um Energieverluste zu minimieren.
Abgesehen von den unerwünschten Energieverlusten lässt Zugluft in den
Wohnungen auch keine rechte Behaglichkeit aufkommen.
Zwar ist zur Minimierung der Luftschadstoffkonzentration in Räumen ein
Mindestluftwechsel erforderlich, aber der Luftzug durch undichte Bauteile ist
gewiss nicht der richtige Weg dies zu erreichen.
Idealrezept: regelmäßiges kurzes Lüften, das eine hohe Luftwechselrate
bringt, ohne gleichzeitig die Räume zu stark abzukühlen. (Stoßlüften!)
Bauphysikalische
Messungen haben gezeigt, dass oft genug aufgrund von Baufehlern durch
Undichtheiten sehr große Energieverluste auftreten. Speziell bei tiefen Außentemperaturen
und starkem Wind kann dies sogar dazu führen, dass Räume nicht mehr
ausreichend beheizt werden können: Zusätzlich zur normalen Raumheizung muss
auch die einströmende kalte Außenluft immer wieder aufgeheizt werden- hohe Wärmeverluste
sind dann die Folge. Eine ungenügend gedämmte Fläche verliert 2 bis 20 mal
mehr Wärme als eine ausreichend gedämmte, Häufig passiert dies als
„schleichender“ Vorgang, der erst bei der nächsten Heizkostenabrechnung
bemerkt wird.
Fenster
Gute Fenster minimieren die Energieverluste und leisten
einen beachtlichen Beitrag zur Wärmeversorgung, indem sie die Sonnenenergie zum
Mitheizen nutzen. Das eingestrahlte Licht wird in Wärme umgewandelt und in den
massiven Bauteilen gespeichert, die die Wärme in den kühleren Abend- und
Nachtstunden dann wieder in den Raum abgeben.
Zwei Faktoren bestimmen den Energieverbrauch:
Die
Wärmedämmwirkung der Verglasung;
Sie lässt sich durch eine Anzahl der Scheiben, eine nicht wahrnehmbare
Metallbedampfung und Edelgasfüllung beeinflussen.
Der Gesamtenergiedurchlassungsgrad oder g-Wert. Je höher dieser desto besser, denn desto mehr Sonnenenergie kann in den Raum einstrahlen.
Am Energieverlust kann der Fensterrahmen einen wesentlichen Anteil haben. Die Verglasung dämmt meist besser als der Rahmen und der Stock – wenige große Fenster sind vorteilhafter als viele kleine.
Türen
Als Teil der Gebäudehülle müssen Hauseingangstüren neben dem Einbruchs-
und Schallschutz auch Witterungs- und Wärmeschutzfunktionen erfüllen. Außentüren
stellen häufig einen thermischen Schwachpunkt des Hauses dar.
Sofern kein angeschlossener Vorbau vorgesehen ist, ist darauf zu achten, dass Außentüren
einen möglichst guten Dämmwert aufweisen.
Dachkonstruktion
Bei ausgebauten Dachgeschoßen ist raumseitig eine Dampfsperre bzw. Dampfbremse
erforderlich. Wichtig ist, dass sie ordnungsgemäß verlegt wird und die Stöße
verklebt werden. Andernfalls kann durch Risse und Fugen in der raumseitigen
Verkleidung die kalte Außenluft ungehindert noch innen bzw. die warme Raumluft
nach außen strömen.
Weitere problematische Stellen im Dachbereich:
der Übergang zwischen Dachschräge und Wand
der Übergang zwischen Dachschräge und Übermauerung
Einbindung von Dachbodentreppen
Einbau von Dachflächenfenstern
Durchführung von Entlüftungsrohren, Kaminen u.ä.
Sonnenschutz
Sonnenschutzmaßnahmen können einerseits konstruktiver Natur
sein, z.b. in Form eines Dachüberstands (Dieser soll so berechnet sein, dass an
der Südseite in den Sommermonaten die Fenster beschattet und im Winter besonnt
werden!), andererseits gibt es technische Vorkehrungen wie Markisen,
Klappfensterläden, Rollläden, Jalousienen, etc.
Außerhalb des Fensters angebrachte Sonnenschutz
Vorkehrungen sind um ein Vielfaches wirksamer als innenliegende Abdeckungen. Zusätzlich
können außenliegende Elemente im Winter auch als Wärmeschutz dienen.
Zu diesem Zweck eignen sich am besten Rollläden oder Fensterladen. Sie
reduzieren die Wärmeverluste, die in der Nacht an Südfenstern entstehen, um
10- 20% und dienen zudem als Sonnenschutz.
Der Wintergarten
Ein richtig geplanter Wintergarten kann sich durchaus positiv
auf die Energiebilanz eines Hauses auswirken, wenn man mit der von der Sonne
erwärmten Luft aus dem Wintergarten bewusst den Wohnraum belüftet und somit
heizt.
Er kann jedoch auch zum "Energiefresser" werden und Mängel bei
der Planung können sich später unangenehm auswirken: in Form von Überhitzung
im Sommer bzw. von zu tiefen Temperaturen im Winter. Und wer im Winter die Tür
zum Wintergarten wegen frostempfindlicher Pflanzen offen lässt oder den
Wintergarten heizt, braucht sich über hohe Heizkostenabrechnungen nicht
wundern. Will man also den Wintergarten ganzjährig als Wohnraum nutzen, so wird
er zwangsläufig zum Energieverschwender. Zur Energieeinsparung trägt ein
Wintergarten nur dann bei, wenn man ihn als Pufferraum betrachtet: Im Frühjahr
und Herbst, wenn es draußen schon kühl ist, kann er als Wohnraum dienen, sonst
stellt er einen Windfang dar und wird gezielt zur Belüftung und Beheizung des
Wohnraumes eingesetzt.
Grundsätze bei der Planung
Um die Sonneneinstrahlung maximal nutzen zu können, sollte ein Wintergarten grundsätzlich nach Süden bzw. Südwesten ausgerichtet sein, und zwar im Idealfall über zwei Stockwerke.
Der wesentliche Faktor bei einem Wintergarten ist natürlich die Verglasung, die dementsprechend qualitativ hochwertig sein sollte. Eine Zweifachverglasung mit möglichst niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten ist daher empfehlenswert.
Etwa 10% der Glasfläche sollten man für den Sommer als Lüftungsöffnung vorsehen.
Da im Winter mit sehr niedrige Temperaturen im Wintergarten zu rechnen ist, sollte dieser gänzlich vom Wohnraum getrennt sein.
Egger, C. (1998). Das Umfassende Nachschlagewerk.
Verband der Elektrizitätswerke Österreichs. (1997). Energie Spar Ratgeber.
Unser
Tagesablauf hängt vom frühen Morgen bis zum späten Abend mit Dienstleistungen
zusammen, die wie selbstverständlich von einer Vielzahl von Elektrogeräten
erbracht werden: vom ersten Griff nach dem Lichtschalter, über das Einschalten
des Radios und den morgendlichen Duft aus der Kaffeemaschine bis zum mittäglichen
Sonntagsmenü aus dem Herd, von der schnellen Kalkulation am Laptop oder Home-
PC bis zum gemütlichen Fernsehabend- von den typischen Hausarbeiten wie Wäsche
waschen oder Bügeln, ganz zu schweigen, die ohne entsprechende Geräte schlicht
undenkbar sind.
Auch wenn, im Vergleich zu den Haushaltseinkommen, die spezifischen Kosten für
Arbeitsleistungen durch Haushalts- Elektrogeräte so gering sind wie nie zuvor,
kann man auch hier bewusst mit Energie umgehen. Sehr häufig lässt sich Strom
durch ein „Gewusst wie“ bei der Bedingung der Geräte einsparen- immer
wichtiger wird auch die richtige Kaufentscheidung: Wer dabei auf Energie-
Effizienz schaut, „kauft“ den geringeren Stromverbrauch für die gesamte
Lebensdauer des Gerätes bewusst mit.
Bei jedem Kauf eines Elektrogeräts steht zunächst natürlich seine Zweckmäßigkeit
im Vordergrund: Wofür genau will ich es verwenden, was muss es alles können,
wie zuverlässig ist das Gerät, kann ich mich auf einen raschen Service
verlassen und: wie viel Strom verbraucht es?
Niedriger Stromverbrauch ist mittlerweile ein wesentliches Kriterium für die
Kaufentscheidung von Geräten geworden. Zu Recht, denn immerhin „leben“
Haushaltsgeräte im Durchschnitt länger als 10 Jahre und dementsprechend fallen
auch die Stromkosten hoch oder niedrig aus.
Heute ist der Gerätevergleich mit dem sogenannten "Energielabel" möglich,
das derzeit für Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner und
Geschirrspülmaschinen gibt. Im Gegensatz zur früheren Produktinformation ist
darauf die Energie- Effizienz der Geräte angegeben, klassifiziert nach den
Buchstaben A bis G, wobei A für niedrigen Verbrauch und G für hohen Verbrauch
steht. Bei den angegebenen Stromverbrauchswerten handelt es sich um Werte, die
unter genormten Prüfbedingungen festgestellt wurden.
| So kann man zum Beispiel Waschmaschinen beim Kauf vergleichen |
| Stromverbrauch von Haushaltsgeräten |
| Energiesparen beim Kochen, Braten und Backen |
So kann man zum Beispiel Waschmaschinen beim Kauf vergleichen
 |
| Verband der Elektrizitätswerke Österreichs. (1999). Strom im Haushalt. Wien. S.4 |
Stromverbrauch von Haushaltsgeräten
Die angegebenen Stromverbrauchsdaten pro Jahr sind
Richtwerte für unterschiedliche Haushaltsgrößen.
Stromverbrauch in kWh
| Gerät |
1-Personen- Haushalt |
2-Personen- Haushalt |
3-Personen- Haushalt |
4-Personen- Haushalt |
für jede weitere Person |
| Elektroherd | 360-720 | 480-840 | 600-960 | 720-1080 | 120 |
| Wasch- maschine |
90-140 | 170-230 | 250-300 | 320-360 | 70 |
| Wäsche- trockner |
140-180 | 240-280 | 330-380 | 450-500 | 100 |
| Geschirr- spül- maschine |
150-180 | 220-250 | 350-400 | 390-430 | 70 |
| Kühlschrank (180 Liter) |
250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | je 10l Nutzinhalt +15 bis 20 kWh |
| Gefriergerät (200-250l) |
270-370 | 270-370 | 270-370 | 270-370 | je 10l Nutzinhalt +15 bis 20 kWh |
| Kleingeräte | 110 | 130 | 150 | 170 | 20 |
| TV-/Hifi- Anlage |
250 | 250 | 250 | 250 | |
| PC | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Beleuchtung | 230 | 340 | 400 | 470 | 50 |
| Warm- wasser |
720 | 1080 | 1450 | 1830 | 380 |
| Verband der Elektrizitätswerke Ö. (1999). Strom im Haushalt. Wien. S6. | |||||
Energiesparen beim Kochen, Braten und Backen
| Elektroherde | Waschmaschine |
| Mikrowellenherde | Wäschetrockner |
| Geschirrspülmaschinen | Die "stillen" Stromverbraucher |
| Kühlschränke | Glühlampen-Energiesparlampen |
Elektroherde
Seit
der Einführung der Elektroherde wurde ständig an Verbesserungen gearbeitet.
Garmethoden wie Braten, Frittieren, Backen, Kochen, Dämpfen oder Dünsten, sind
heute kinderleicht, und die einzelnen Arbeitsvorgänge benötigen nur noch ein
Minimum an Strom. Diese Vorteile sind auch der Grund dafür, dass mehr als drei
Viertel der österreichischen Haushalte elektrisch kochen. Nur ein Viertel kocht
mit Gas.
Wird regelmäßig gekocht benötigt der Elektroherd bis zu einem Viertel des
Stromverbrauchs im Haushalt. Wird beim Kochen der Strom effizient genutzt,
leistet dies einen großen Beitrag, den Stromverbrauch im Haushalt zu
optimieren.
Tipps zur sinnvollen Anwendung:
Mikrowellengeräte
Immer mehr Österreicher benützen bereits die
Vorteile eines Mikrowellengeräts bei der Speisezubereitung. Die Spezialität
dieses Geräts ist die schnelle Erwärmung von Speisen. Dabei können im
Vergleich zur Zubereitung auf der Kochstelle bis zu 70% Strom eingespart werden.
Tipps zur sinnvollen Anwendung:
- Flüssigkeiten
bis zu ½ Liter können in Mikros schneller und sparsamer erwärmt werden, als
auf der Ofenplatte.
- Um das Austrocknen der Speisen zu verhindern und ein Verschmutzen der Gerätes,
werden die meisten Speisen zugedeckt.
Geschirrspülmaschinen
Das
maschinelle Geschirrspülen befreit nicht nur von unangenehmer Arbeit und
erspart ¾ der Arbeitszeit- es ist auch sparsamer als händisch abwaschen.
Tipps zur sinnvollen Anwendung:
- Händisches Vorspülen unter fließendem Wasser ist meist
nicht notwendig.
- 60
cm breite Geräte arbeiten bei voller Beladung wirtschaftlicher als 45cm breite.
- Das Spülprogramm richtig wählen, spart Strom und Zeit.
- Am wirtschaftlichsten ist es, erst dann abzuwaschen, wenn das Gerät randvoll
ist.
- Man sollte sich bei der Zugabe von Reinigern zurückhalten und an die
Dosierungsangaben halten.
- Werden Geschirrspüler ans Warmwasser angeschlossen, verkürzt sich die Spülzeit
und verringert sich der Stromverbrauch (Vorsicht: nur sinnvoll, wenn Warmwasser
kostengünstig!)
Kühlschränke
Ein
Haushalt ohne Kühlschrank ist heute undenkbar. Kühlschränke bieten Lagermöglichkeiten
für leicht verderbliche Lebensmittel, diese ermöglichen die Vorratshaltung
direkt in der Küche und sind einfach und problemlos in der Bedienung und können
–je nach Ausstattung- zusätzlich auch Gefriergut lagern. Moderne Geräte
haben teilweise auch Bereiche mit Kellertemperaturen.
Tipps zur sinnvollen Anwendung:
-
Man sollte gekochte Speisen zuerst auf Raumtemperatur abkühlen lassen, bevor
man sie in den Kühlschrank gibt.
- Erst bei einer Temperatur von 4 °C stellen die lebensmittelverderbenden
Bakterien ihr Wachstum ein. Der oft propagierte Energiesparbetrieb ist fragwürdig,
da dies oft zum schnelleren Verderben der Lebensmittel führen kann. Moderne Kühlgeräte
benötigen im Monat nur noch 10 bis 30 kWh Strom, das sind ca 20 bis 60
Schilling. Wird in einem Monat ein Joghurt durch wärmere Lagerung ungenießbar,
geht mehr Energie und Geld verloren, als mit dem Höherstellen der Temperatur
eingespart werden kann.
- In den Türfächern ist die Temperatur am höchsten. Hier sind
Lebensmittel unterzubringen. Hier sind Lebensmittel unterzubringen, die nur
leicht gekühlt werden sollen.
- In der sogenannten Frischhaltezone können Lebensmittel länger frisch
gehalten werden als im herkömmlichen Kühlfach. Hier herrschen Temperaturen um
ca 1°C, und die relative Luftfeuchtigkeit kann auf bis zu 90% erhöht werden.
- Im Kellerfach( ( bis 14°C) werden Getränke und kälteempfindliches Obst und
Gemüse gelagert.
- Man sollte auch die Einbauvorschriften beachten! Um die nötige
Luftzirkulation nicht zu behindern, müssen die Lüftungsschlitze unbedingt frei
bleiben.
Waschmaschine
Der
Wascherfolg hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Besteht ein Idealverhältnis
zwischen Trommelinhalt, Wassermenge, Wäschebewegung, Temperatur und Dauer des
Waschens sowie der Waschmitteldosierung, dann wird die Wäsche sowohl schonend
als auch gründlich gewaschen.
Tipps zur sinnvollen Anwendung:
-
Bei Koch- und Buntwäsche sollte man die Maschine voll beladen. (oberhalb der
eingefüllten Wäsche noch handhoch freier Raum bis zur Trommelwand). Für Feinwäsche,
Pflegeleichtes und Wolle füllt man entsprechend weniger ein.
- Nicht zuviel Waschmittel verwenden. Es heißt nicht immer: Je mehr
Waschmittel, desto sauberer ist die Wäsche.
- Vorwaschen ist nur bei besonders verschmutzter Wäsche notwendig.
Wäschetrockner
Jeder
Trockenvorgang braucht Energie- nur die Sonne macht’s gratis! Abgesehen vom
Aufhängen der Wäsche im Freien sind elektrische Wäschetrockner am
wirtschaftlichsten.
Die
"stillen" Stromverbraucher
Standby ist eine angenehme Sache- denn mit
dieser Schaltung sind Geräte, wie z.B Fernsehgeräte, Videorecorder, Sat-
Anlagen, Stereoanlagen u.ä. immer betriebsbereit. Dieser Komfort ist allerdings
mit zusätzlichem Stromverbrauch verbunden. Elektrische Uhren von Elektrogeräten
verbrauchen zwischen 17 und 35 kWh pro Jahr pro Gerät.
Tipps zur sinnvollen Anwendung:
- Im
Bereich der Unterhaltungselektronik ist das Ausschalten bei Nichtgebrauch
zweifellos die einfachste Stromsparmaßnahme. Beim Gerätekauf sollte man sich
daher auch nach dem Standby- Verbrauch erkundigen.
- Die Tabelle gibt einen Überblick, wieviel Energie unsere „stillen“
Stromverbraucher im Jahr benötigen. Angegeben ist der Stromverbrauch in kWh pro
Jahr. Für die Berechnung des Jahresstroms ist eine bestimmte Nutzungshäufigkeit
angenommen worden, um grobe Anhaltswerte geben zu können.
| Gerät |
Berechnungsgrundlagen |
Tage/Jahr |
Stromverbrauch Standby kWh/Jahr |
| Farbfernseher | 20 | 365 | 57 |
| Videorecorder | 23 | 365 | 67 |
| Receiver der Sat-Anlage | 24 | 365 | 79 |
| Stereoanlage | 20 | 365 | 73 |
| 20-W-Halogenlampe mit Steckernetzteil |
24 | 365 | 44 |
| Telefax | 24 | 365 | 26 |
| Mobiltelefon Schnurlostelefon |
24 | 365 | 52 |
| PC | 8 | 220 | 70 |
| Tintenstrahldrucker | 8 | 220 | 12 |
| Nadeldrucker | 8 | 220 | 39 |
|
Verband der Elektrizitätswerke Ö. (1999). Strom im Haushalt. Wien. S18. |
|||
Der Stromverbrauch für die Beleuchtung wird oft überschätzt, und noch immer wird manchmal Energiesparen mit Lichtsparen gleichgesetzt. Doch von den rund 4000 kWh, die in Österreichs Haushalten durchschnittlich verbraucht werden, entfällt nur ein geringer Teil auf die Beleuchtung, nämlich –je nach Ausstattung und Nutzgewohnheiten- ca. 5 bis 10%. Dass bei der Innen- und Außenbeleuchtung die Wahl der richtigen Lampen und durch überlegten Einsatz des Lichtes Strom und Geld gespart werden können, ist keine Frage. Natürlich darf aber die Sparsamkeit nie auf Kosten der Augen und der Sicherheit gehen.
Tipps zur richtigen Anwendung:
- Grundsätzlich
gilt: Nicht benötigte Lichtquellen abschalten. Eine Ausnahme bilden
Leuchtstofflampen mit konventionellen Vorschaltgeräten. Da zu häufiges
Schalten die Lebensdauer dieser Lampen verringert, sollten sie nur ausgeschaltet
werden, wenn sie länger als 20 min nicht benötigt werden.
- Auf eine geeignete Leuchte achten. (Licht soll weder verschluckt werden, noch
sollte man geblendet werden).
- Reflektierende Lampenschirme sollten verwendet werden. Das gibt mehr Licht und
braucht weniger Strom.
- Außenbeleuchtungen sollten durch Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder
Dämmerungssensoren geschaltet werden.
Glühlampen - Energiesparlampen
|
|
| Vergleich | Glühlampe | Energiesparlampe |
| Anschlusswert | 100W | 20W |
| Tägliche Einschaltdauer | 4 Stunden | 4 Stunden |
| Lebensdauer einer Lampe |
1000 Stunden (8 Monate) |
10000 Stunden (6 Jahre, 8 Monate) |
| Das ist in 6 Jahren, 8 Monaten Stromverbrauch Stromkosten |
1000 kWh 2000 Schilling |
200 kWh 400 Schilling |
| Anschaffungskosten für | 10 Lampen ca. 175 Schilling |
1 Lampe ca. 260 Schilling |
| Gesamtkosten (Stromkosten und Anschaffungskosten) |
2 175 Schilling |
660 Schilling |
| Ersparnis über 6 Jahre, 8 Monate | 1515 Schilling | |
| Verband der Elektrizitätswerke Ö. (1999). Strom im Haushalt. S.20 | ||
Warmwasser
Dass aus dem Wasserhahn oder aus der Brause warmes Wasser sprudelt,
zählt zu den Selbstverständlichkeiten unserer Haushalte. Wir nützen es zum
Baden, Duschen, Händewaschen, zum Geschirrspülen, Kochen und zur
Wohnungsreinigung - ohne uns viele Gedanken zum Preis dieser Wärme zu machen. Oft
läßt sich auch der dafür notwendige Energieverbrauch gar nicht feststellen-
etwa wenn ein Heizungskessel als „Nebenprodukt“ auch das Warmwasser liefert.
Gratis ist warmes Wasser natürlich nicht: Es kostet immer Energie in Form von
Heizöl, Gas, Kohle, Holz oder Strom- es sei denn, man hat eine
Sonnenkollektoranlage installiert. Im Durchschnittshaushalt werden immerhin 13%
des gesamten Energiebedarfs für die Warmwasserbereitung aufgewendet.
Energiequellen für die Warmwasserbereitung
Für die Warmwasserwärmung gibt es eine fast unbegrenzte Fülle an
technischen Möglichkeiten- je nach eingesetzter Energieform und individuellen
Bedürfnissen. Die Wahl der optimalen Lösung garantiert dabei einen möglichst
effizienten und sparsamen Energie- Einsatz.
Einige Möglichkeiten zur Bereitung von Warmwasser:
Energiespartipps
beim Warmwasser:
- Duschen statt baden.
- Anwendung von fließendem Warmwasser einschränken. Beim Rasieren oder Zähneputzen
läuft oft die ganze Zeit das Wasser.
- Keine tropfenden Wasserhähne.
- Abstellen der Warmwassergeräte. Dies
empfiehlt sich bei längerer Abwesenheit (Urlaub).
- Einhandmischer und Thermostatbatterien. Wenn das Warmwasser gleich mit der
richtigen Temperatur aus dem Wasserhahn kommt, gibt es keine Leerläufe.
- Trennung von der Heizanlage. Wenn das Warmwasser im Zentralheizungskessel erwärmt
wird, sollte man für den Sommerbetrieb einen eigenen Warmwasserspeicher nutzen.
- Intelligente Planung. Im Neubau besteht die Chance, durch geschickte Planung
der Räume und Zapfstellen kurze Warmwasserwege zu erreichen. Vom Material her
werden heute hauptsächlich Kunststoffrohre verwendet.
Verband der Elektrizitätswerke
Österreichs. (1999). Warm Wasser. Wien.
Egger,C. (1998). Das umfassende Nachschlagewerk zum Thema Bauen, Wohnen und
Energiesparen. Wien.
Literatur
Egger, C.(1998). Das umfassende Nachschlagewerk zum Thema Bauen, Wohnen und
Energiesparen.
Verband der Elektrizitätswerke Österreichs. (1999). Energiesparratgeber. Wien
Verband der Elektrizitätswerke Österreichs. (1999). Strom im Haushalt. Wien.
Verband der Elektrizitätswerke Ö. (1999). Warmwasser. Wien.
Hörfunk Marketing. (1997). Energie verwenden statt verschwenden.
|
|
||||||||

|
|
|||||||
| Anregungen, Tipps, Wünsche an zip@.padl.ac.at | ||||||||